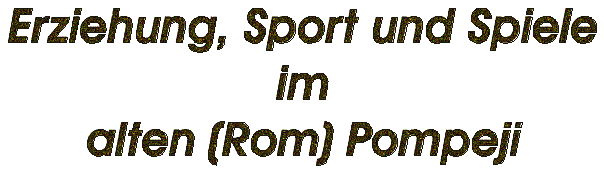
Inhaltsverzeichnis
1.
Römische Erziehung
und Bildung
1.1. Allgemeine
Informationen
1.2. Charakteristik
der römischen Erziehung
1.3. Schulische
Erziehung – historisch gesehen –
1.4. Ludus
(Elementarschule)
1.5.
Grammaticus (Literaturschule)
1.6.
Rhetorikschule (Redeschule)
2. Sport im antiken Pompeji (Rom)
3. Spiele im antiken Pompeji (Rom)
3.1. Verschiedene Arten der Spiele
3.1.1.
Die Gladiatorenspiele
3.1.2.
Tierhetzen (venationes)
3.1.3.
Naumachien
3.1.4.
Die Wagenrennen
3.2. Das Theaterspiel
3.3. Verschiedene Theaterinszenierungen
3.3.1.
Die Fabula Atellana
3.3.2.
Der Mimus
3.3.3.
Der Pantomimus
3.3.4.
Die römische Tragödie
3.3.5.
Die römische Komödie
4. Quellenverzeichnis
1.
Römische Erziehung
und Bildung
1.1. Allgemeine Informationen
In der
frühkindlichen Erziehung wurde der Mutter, der Amme, überhaupt der gesamten
Familie eine große Bedeutung zugeschrieben. Anhand dieser Bezugspersonen lernte
das Kind die Sitten, Bräuche und Normen der Gesellschaft, in der es aufwuchs,
kennen. Das Kind ahmte beobachtete Verhaltensweisen nach und gewöhnte sich mit
der Zeit an diese. Man kann unter zwei Erziehungsmaßnahmen unterscheiden: die
Eine, in der der Säugling von der Mutter gestillt wurde und bei ihr aufwuchs
und die Zweite, in der das Kind einer griechischen Magd oder einer Sklavin
übergeben wurde, die zu dieser Zeit auch Kinder hatte. Dies hatte natürlich den
Vorteil, dass das Kind zweisprachig aufwuchs und griechisch später nicht
nachlernen musste. Die weitere Erziehung der Kinder übernahm der Vater als „Familienoberhaupt“
kraft seiner väterlichen Vollzugsgewalt übernommen. Der Vater brachte seinem
Sohn allerhand Sportarten bei, wie Reiten und Fechten aber auch Faustkampf und
verschiedene Überlebenstechniken. Außerdem erzählte er seinem Kind von den
Taten und Sitten seiner Vorfahren.
1.2.
Charakteristik der römischen Erziehung
Erziehung und
Ausbildung dienten nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Betonung
ethischer Werte. Doch waren die Römer vor allem an der praktischen Seite des
vermittelten Wissens interessiert. Der Rechenunterricht stattete den Händler
und Kaufmann, aber auch den Landvermesser mit den für seinen Beruf nötigen Kenntnissen
aus. (Erziehung nach Vorbildern, die aus der eigenen Familie oder aus der
Geschichte genommen wurden.)
1.3.
Schulische Erziehung – historisch gesehen –
Zunächst
erfolgte Erziehung und Unterricht durch die Eltern selbst als Haus Unterricht.
Im Laufe der Zeit unterstützte sie dabei ein „paedagogus“, ein intelligenter
und gebildeter Freigelassener oder Sklave. Die Schulbildung blieb also privaten
Initiativen interessierter Eltern überlassen. Staatlich bereitgestellte Schulen
- sowohl Gebäude als auch öffentliche Lehrer - waren unbekannt. Eine allgemeine
Schulpflicht war ebenfalls unbekannt. Die Bildung der Mädchen wurde selbst in
höheren sozialen Schichten vernachlässigt. Das Vorbild der Eltern und die
starke Bindung an die Vatersitten bestimmten den jungen Menschen von klein auf.
Das Schulwesen trug auch dazu bei, die doppelte (griechische und lateinische)
Kultur zu festigen.
Erst in der
Kaiserzeit wurden auch öffentliche Schulen eingeführt. Es kam zur Gründung von
Ausbildungszentren mit Universitätscharakter. Vespasian richtete in Rom zwei
staatlich besoldete Lehrstühle für griechische und römische Rhetorik ein. Besondere
Förderung erfuhren die Schuleinrichtungen durch Trajan und Hadrian. Die Kaiser
bestellten für diese Schulen staatlich besoldete Lehrer.
1.4.
Ludus (Elementarschule)
Der
Unterricht im Ludus war für die 7 bis 12jährigen Kinder. Der Lehrer unterwies
die Kinder im Lesen, Schreiben und den Grundkenntnissen des Rechnens. Wenn der
Schüler das ganze Alphabet beherrschte, lernte er Silben, Wörter, zusammenhängende
Texte und Geschichten, meist mit moralischem Inhalt. Römische Schüler mussten
zur Förderung des Gedächtnisses oft Texte auswendig lernen. Mathematik lernte
man durch einen Mathematiklehrer (calculator). Der Unterricht begann meist
schon vor Sonnenaufgang und dauerte, unterbrochen durch eine kurze Mittagspause,
bis spät in den Nachmittag hinein. Darum vertraute man das Kind, wegen der
Gefahren der Straße und für den
Schulweg einem Paedagogus an. Mit der Elementarschule schloss die Ausbildung
der Kinder aus wenig bemittelten Schichten.
1.5.
Grammaticus (Literaturschule)
Begüterte
Familien schickten ihre Söhne nach der Grundschule zu einem Grammatiklehrer.
Die Schule des Grammaticus beschäftigte sich mit höherer Lektüre wie Ennius,
Terenz, Livius, Cicero, Vergil, Andronicus etc. Mit der Lektüre waren
Erklärungen zum Text verbunden, die von der Grammatik bis zum Stil ging. Es
wurden aber auch andere Wissensgebiete behandelt wie Poetik,
Literaturgeschichte, Mythologie, Philosophie, Geschichte, Geographie, Physik
und Astronomie. In der Regel war die Schulbildung des jungen Römers mit der
Eintragung in die Bürgerlisten (mit etwa 17 Jahren) abgeschlossen. Vermögende
Familien wandten allerdings beträchtliche Mittel auf, um ihren Söhnen eine
Ausbildung an einer Rhetorikschule zu ermöglichen.
1.6.
Rhetorikschule (Redeschule)
Der
Rhetorikunterricht wurde an namhaften Bildungsstätten wie Rom, Athen, Rhodos,
Pergamon oder Alexandria vermittelt. Die Gebäude wurden von pompejanischen
Architekten gestaltet und sahen von außen wie ein Ladenaus. Überschritt der
Schüler jedoch die Schwelle, stand er in einem weitläufigem Raum, dessen
vorderer Teil einen Garten darstellte, der von dem hohem Schiebefenster über
der Tür erhellt wurde. Pflanzen wuchsen in Töpfen, die auf dem Boden
aufgestellt waren, oder täuschend ähnliche Abbildungen stellten Früchte,
Pflanzen und Blüten dar. Im hinteren Teil befand sich eine Pergola, die auf
ihren Bänken Platz für fünfzehn Schüler und ihren Lehrer bot. Gelehrt wurde von
einem Rhetor, dem Lehrer für Beredsamkeit. Schwerpunkt der Ausbildung war
Rhetorik und Philosophie. Die Ausbildung in dieser Schule war Voraussetzung für
einen Politiker oder Juristen.
2. Sport im antiken Pompeji
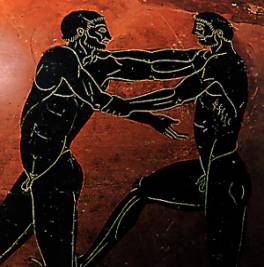 Für den Menschen der Antike
gehörte zu einer umfassenden Erziehung auch die harmonische Entwicklung des Körpers.
Sportliche Betätigung spielt eine wichtige Rolle in allen Schulprogrammen. Auf
der Palästra wurde der tägliche Sportunterricht ausgeübt. Der junge Bürger hat
den Ehrgeiz, seine Kraft und Geschicklichkeit zu bewahren, und alle Pompejaner
treiben in den Thermen Körperhygiene. Aber nicht nur diesem Zweck dienen die
Bädereinrichtungen, die für die römische Zivilisation so charakteristisch sind:
Sie befriedigen auch das Bedürfnis nach otium, nach Muße, die sich zusammensetzt
aus Sport, gelehrten Gesprächen und Ruhe.
Für den Menschen der Antike
gehörte zu einer umfassenden Erziehung auch die harmonische Entwicklung des Körpers.
Sportliche Betätigung spielt eine wichtige Rolle in allen Schulprogrammen. Auf
der Palästra wurde der tägliche Sportunterricht ausgeübt. Der junge Bürger hat
den Ehrgeiz, seine Kraft und Geschicklichkeit zu bewahren, und alle Pompejaner
treiben in den Thermen Körperhygiene. Aber nicht nur diesem Zweck dienen die
Bädereinrichtungen, die für die römische Zivilisation so charakteristisch sind:
Sie befriedigen auch das Bedürfnis nach otium, nach Muße, die sich zusammensetzt
aus Sport, gelehrten Gesprächen und Ruhe.
Zunächst ist
festzuhalten, dass die sportlichen Übungen von Menschen ausgeführt werden, die
nur ihre körperliche Gewandtheit entwickeln wollen. Die häufigsten und am
meisten geschätzten Übungen waren der Diskuswurf, der Sprung mit Gewichten und
das sehr populäre Ringen. Sport war populär. Doch gewisse Übungen haben einen
speziellen militärischen Charakter. Die Graffiti der Palästra erwähnen Schwadronen
und Zenturien – die Bezeichnung Schwadron galt für die Reiterei, Zenturie für
die Fußsoldaten.
 Am Marsfeld übten die jungen Römer Laufen, Springen, Ring-
und Faustkampf, Speerwerfen, Fechten und Reiten. Zum Ausgleich wurde das
allgemein beliebte Ballspiel betreiben. Bei den öffentlichen Wettkämpfen (z.B.
Laufwettbewerbe, Ring- und Faustkämpfe) beteiligten sich die Römer meistens
aber lediglich als Zuschauer und ließen Sklaven und Athleten von außerhalb
gegeneinander kämpfen. Erstmalig ließ Fulvius Nobilior im Jahre 186 v. Chr. Griechische
Athleten in Rom auftreten. Sulla verlegte schließlich die Olympischen Spiele um
80 v. Chr. von Athen nach Rom. Nero nahm sogar in Olympia aktiv als Wagenlenker
an den Kämpfen teil. So erlebten auch die alten Spiele (Laufen, Springen,...)
in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit eine neue Blüte. Das öffentliche Interesse
der Römer blieb jedoch mehr auf das Zuschauen beschränkt. Dagegen fasste die
griechische Ausgleichs- und Heilgymnastik bei den jungen Römern besser Fuß.
Am Marsfeld übten die jungen Römer Laufen, Springen, Ring-
und Faustkampf, Speerwerfen, Fechten und Reiten. Zum Ausgleich wurde das
allgemein beliebte Ballspiel betreiben. Bei den öffentlichen Wettkämpfen (z.B.
Laufwettbewerbe, Ring- und Faustkämpfe) beteiligten sich die Römer meistens
aber lediglich als Zuschauer und ließen Sklaven und Athleten von außerhalb
gegeneinander kämpfen. Erstmalig ließ Fulvius Nobilior im Jahre 186 v. Chr. Griechische
Athleten in Rom auftreten. Sulla verlegte schließlich die Olympischen Spiele um
80 v. Chr. von Athen nach Rom. Nero nahm sogar in Olympia aktiv als Wagenlenker
an den Kämpfen teil. So erlebten auch die alten Spiele (Laufen, Springen,...)
in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit eine neue Blüte. Das öffentliche Interesse
der Römer blieb jedoch mehr auf das Zuschauen beschränkt. Dagegen fasste die
griechische Ausgleichs- und Heilgymnastik bei den jungen Römern besser Fuß.
3. Spiele im antiken Pompeji (Rom)
Die öffentlichen Spiele, die man dem römischen
Volke bot, wurden allgemein mit „ludi“ bezeichnet. Es gab grundsätzlich zwei
Arten von ludi: die Zirkusspiele (ludi circenses) zu denen man
vorwiegend die Gladiatorenkämpfe (ludi gladiatorii oder munera)
und die Wagenrennen zählte und die Theatervorstellungen (ludi scaenici).
Die bedeutendsten fanden aber alljährlich zu festgesetzten Daten statt (ludi
stati).
Die ludi
circenses, zu denen man vorwiegend die überaus beliebten Wagenrennen und die
unterschiedlichsten Gladiatorenkämpfe zählte, fanden in Rom zumeist im Circus
Maximus oder im Circus Flaminius statt. Später auch im Amphitheater der Flavier
(Kolosseum). Seit der Errichtung des Kolosseums begann man in Rom allerdings
eine Trennung der ludi circenses. Von nun an wurden die Gladiatorenkämpfe, die
munera, vorwiegend in den eigens für sie gebauten Amphitheatern veranstaltet.
Die Wagenrennen blieben im ursprünglichen Circus.
Die ludi
(Spiele) waren den Römern kostenlos zugänglich. So kam es, dass die Tribünen
mehr als einmal unter dem ungeheuren Ansturm der Bevölkerung zusammengebrochen
waren. Man nahm stets Speisen und Getränke mit und versuchte, möglichst früh
einen günstigen Sitzplatz zu erhaschen. Die unteren Sitzreihen waren stets dem
Kaiser, der eine eigene Loge hatte, und seinem Hofstaat vorbehalten. Im ersten
Rang saßen die römischen Adeligen und Ritter, im Zweiten die wohlhabenden
Bürger, Beamten und Offiziere. Im obersten Stockwerk befanden sich die Stehplätze
für das einfache Volk. Die Zuschauer fanden durch ein ausgeklügeltes System von
Ein- und Aufgängen innerhalb kürzester Zeit zu den nummerierten Plätzen. Das Warten
auf die Spiele wurde meistens mit Geschrei, Späßen und Unfug überbrückt.
Die ludi
circenses, die aus einem religiösen Ursprung entsprangen, folgten einem genau
festgelegten Zeremoniell, das wiederholt werden musste, wenn es nicht eingehalten
wurde. Sie bestanden aus zwei Teilen, der pompa und dem Rennen. Die pompa war
eine Prozession, die vom Kapitol zum Zirkus verlief, und sich erst vor der Loge
des Kaisers auflöste. An der pompa waren der Veranstalter (Magistrat),
Priester, Wettkämpfer, Musikanten, Tänzer und die Jugend beteiligt. Im Zirkus,
in dem sich inzwischen die Menge versammelt hatte, schloss man Wetten ab und
machte neue Bekanntschaften. Unter der Tribüne hatten sich die Quadrigen in einer
durch das Los bestimmten Reihenfolge aufgestellt und warteten auf das
Startzeichen. Dieses bestand darin, dass der Magistrat ein weißes Tuch in die
Arena fallen ließ.
3.1.
Verschiedene Arten der Spiele
3.1.1.
Die Gladiatorenspiele
 Die Gladiatoren, die manchmal
auch wegen ihrer umfangreichen Ausbildung als Soldaten verwendet wurden, waren
je nach ihren Fähigkeiten unterschiedlich ausgebildet, wodurch jedem Treffen
ein gewisser Grad an Unsicherheit verliehen wurde. Das wiederum machte die Wetten
interessanter. Nicht jedoch die Wetten, sondern allein die Freude am Kampf zog
das Publikum ins Amphitheater. Die Gladiatoren setzten sich aus gekauften
Sklaven, Kriegsgefangenen, zum Tode Verurteilten und Freien zusammen, die sich
für eine bestimmte Zeit verkauften. Manchmal wurden sogar Senatoren und Frauen
zur Teilnahme an den Gladiatorenkämpfen gezwungen. In gefährlichen Augenblicken
suchte manchmal sogar der Kaiser die Hilfe dieser Gladiatoren, die einerseits
gesellschaftlich geächtet, andererseits jedoch vom Ruhm ihrer Siege in der Arena
umgeben waren. Nicht selten waren die Gladiatoren ebenso beliebt wie gefürchtet.
Am Tag vor dem Kampf wurde für die Gladiatoren unter den Blicken der Neugierigen
ein öffentlicher Festschmaus veranstaltet. Am folgenden Tag zogen sie dann zunächst
unbewaffnet ins Amphitheater ein, um dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu erweisen:
,,Ave imperator, morituri te salutant." Dann begannen sie nach der Prüfung
und Verteilung der Waffen den Kampf. Die Kämpfer waren je nach Kampfart verschieden
bewaffnet.
Die Gladiatoren, die manchmal
auch wegen ihrer umfangreichen Ausbildung als Soldaten verwendet wurden, waren
je nach ihren Fähigkeiten unterschiedlich ausgebildet, wodurch jedem Treffen
ein gewisser Grad an Unsicherheit verliehen wurde. Das wiederum machte die Wetten
interessanter. Nicht jedoch die Wetten, sondern allein die Freude am Kampf zog
das Publikum ins Amphitheater. Die Gladiatoren setzten sich aus gekauften
Sklaven, Kriegsgefangenen, zum Tode Verurteilten und Freien zusammen, die sich
für eine bestimmte Zeit verkauften. Manchmal wurden sogar Senatoren und Frauen
zur Teilnahme an den Gladiatorenkämpfen gezwungen. In gefährlichen Augenblicken
suchte manchmal sogar der Kaiser die Hilfe dieser Gladiatoren, die einerseits
gesellschaftlich geächtet, andererseits jedoch vom Ruhm ihrer Siege in der Arena
umgeben waren. Nicht selten waren die Gladiatoren ebenso beliebt wie gefürchtet.
Am Tag vor dem Kampf wurde für die Gladiatoren unter den Blicken der Neugierigen
ein öffentlicher Festschmaus veranstaltet. Am folgenden Tag zogen sie dann zunächst
unbewaffnet ins Amphitheater ein, um dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu erweisen:
,,Ave imperator, morituri te salutant." Dann begannen sie nach der Prüfung
und Verteilung der Waffen den Kampf. Die Kämpfer waren je nach Kampfart verschieden
bewaffnet.
3.1.2.
Tierhetzen (venationes)
 Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.
wurden auch Tierhetzen veranstaltet - zuerst ausschließlich im Circus Maximus,
später vorwiegend in den Amphitheatern. Sie boten den Zuschauern Abwechslung
von den eigentlichen Gladiatorenspielen und etablierten sich bald als fester
Programmteil eines jeden Kampfprogramms. Manchmal waren die Tierhetzen
allerdings ein einziges Gemetzel, da schwerbewaffnete Gladiatoren und Bogenschützen
auf die nun hilflosen Tiere losgelassen wurden. So kam es, dass manchmal bis zu
dreitausend Tiere bei einer einzigen venatio getötet wurden. Um den immensen Bedarf
an Tieren zu decken, jagte man in den heimischen Wäldern, in Kleinasien,
Afghanistan und weiten Gebieten Afrikas nach Löwen, Leoparden, Bären, Rehen,
Hirschen, Straussen,...
Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.
wurden auch Tierhetzen veranstaltet - zuerst ausschließlich im Circus Maximus,
später vorwiegend in den Amphitheatern. Sie boten den Zuschauern Abwechslung
von den eigentlichen Gladiatorenspielen und etablierten sich bald als fester
Programmteil eines jeden Kampfprogramms. Manchmal waren die Tierhetzen
allerdings ein einziges Gemetzel, da schwerbewaffnete Gladiatoren und Bogenschützen
auf die nun hilflosen Tiere losgelassen wurden. So kam es, dass manchmal bis zu
dreitausend Tiere bei einer einzigen venatio getötet wurden. Um den immensen Bedarf
an Tieren zu decken, jagte man in den heimischen Wäldern, in Kleinasien,
Afghanistan und weiten Gebieten Afrikas nach Löwen, Leoparden, Bären, Rehen,
Hirschen, Straussen,...
Es gab
verschiedene Arten von Tierkämpfen:
§
Hinrichtungen von „ad bestias" Verurteilten durch Löwen, Leoparden,
Bären,... Die Opfer wurden zu diesem Zweck oft an Pfähle gebunden oder mit Peitschen
den Tieren entgegengeprügelt. Manchmal warf man die Verurteilten in Käfige oder
band sie z. B. auf den Rücken eines Stieres fest.
§
Der Kampf Tier gegen Tier. Die Veranstalter ließen dabei die Tiere
gegeneinander kämpfen, die nach damaliger Meinung natürliche Feinde waren: Elefant
- Nashorn, Stier - Bär, Löwe - Leopard,... wobei die Tiere gewöhnlich
aneinander angekettet wurden, um den Kampf spannender zu gestalten und sie an
der Flucht zu hindern.
§
Der Kampf Tier gegen Venator(Jäger). Hier variierte das Angebot stark
von riesigen Hetzjagden auf Rehe, Hirsche und anderem Wild mit Pfeilen und Speeren
bis hin zu Einzelkämpfen zwischen Raubtier und bewaffnetem Venator.
3.1.3.
Naumachien
 Die Naumachie oder 'naumachia' war die ausgefallenste und
kostenspieligste Form des Gladiatorenkampfes. Als Naumachien bezeichnete man
die wirklichkeitsgetreuen Nachstellungen von großen Seeschlachten. Zu diesem
Zweck wurden eigens ein künstlicher See ausgehoben, tausende Gladiatoren angeheuert
und eine Unmenge von Schiffen herbeigebracht. Erfinder der großen Naumachie war
Julius Caesar; er ließ 46 v. Chr. auf dem Marsfeld einen riesigen See ausheben
und machte eine Seeschlacht zwischen den Phöniziern und Ägyptern nach.
Die Naumachie oder 'naumachia' war die ausgefallenste und
kostenspieligste Form des Gladiatorenkampfes. Als Naumachien bezeichnete man
die wirklichkeitsgetreuen Nachstellungen von großen Seeschlachten. Zu diesem
Zweck wurden eigens ein künstlicher See ausgehoben, tausende Gladiatoren angeheuert
und eine Unmenge von Schiffen herbeigebracht. Erfinder der großen Naumachie war
Julius Caesar; er ließ 46 v. Chr. auf dem Marsfeld einen riesigen See ausheben
und machte eine Seeschlacht zwischen den Phöniziern und Ägyptern nach.
Nach Caesars
Tod versumpfte der See. Augustus ließ 2 v. Chr. erneut einen Teich in den
Ausmaßen von etwa 560m x 540m auf dem Marsfeld ausheben und über 6000 Gladiatoren
gegeneinander kämpfen. Anlass war hier die Einweihung des zu Ehren Caesars errichteten
Marstempels. Weitere große Naumachien fanden unter Claudius und Trajan statt.
3.1.4.
Die Wagenrennen
 In der republikanischen Zeit
galt es für römische Bürger als Ehre, an den Festtagen der (capitolinischen)
Gottheiten den Rennwagen zu besteigen. Damals hatte man auch die Wagenrennen
auf die Zeit einer Stunde beschränkt. Zum Ende der republikanischen Zeit
verweltlichten die Spiele immer mehr. Der Bürger überließ das Geschäft des
Wagenlenkens Sklaven und Freigelassenen. Die Zeit, die den Rennen eingeräumt
wurde, wuchs. Zehn bis zwölf Rennen über einen Zeitraum von sechs bis acht
Stunden waren in der Kaiserzeit normal. Caligula bspw. ließ an einem Tag vierundzwanzigmal
rennen - und die Zahl stieg, was sogar dazu führte, dass die Anzahl der Runden
von sieben auf fünf herabgesetzt wurde, um die Wagenrennen noch vor Ende des
Tages abschließen zu können. Vor allem für die Vorführung der Wagenrennen
wurden eigene Gebäude errichtet. Als die Bekanntesten werden erwähnt der Circus
Flaminius auf dem Marsfeld, der Circus Gai auf dem vatikanischen Hügel, das Stadion
des Domitian, dessen Raum jetzt die Piazza Navona einnimmt, und schließlich der
älteste, größte und berühmteste von allen, der Circus Maximus.
In der republikanischen Zeit
galt es für römische Bürger als Ehre, an den Festtagen der (capitolinischen)
Gottheiten den Rennwagen zu besteigen. Damals hatte man auch die Wagenrennen
auf die Zeit einer Stunde beschränkt. Zum Ende der republikanischen Zeit
verweltlichten die Spiele immer mehr. Der Bürger überließ das Geschäft des
Wagenlenkens Sklaven und Freigelassenen. Die Zeit, die den Rennen eingeräumt
wurde, wuchs. Zehn bis zwölf Rennen über einen Zeitraum von sechs bis acht
Stunden waren in der Kaiserzeit normal. Caligula bspw. ließ an einem Tag vierundzwanzigmal
rennen - und die Zahl stieg, was sogar dazu führte, dass die Anzahl der Runden
von sieben auf fünf herabgesetzt wurde, um die Wagenrennen noch vor Ende des
Tages abschließen zu können. Vor allem für die Vorführung der Wagenrennen
wurden eigene Gebäude errichtet. Als die Bekanntesten werden erwähnt der Circus
Flaminius auf dem Marsfeld, der Circus Gai auf dem vatikanischen Hügel, das Stadion
des Domitian, dessen Raum jetzt die Piazza Navona einnimmt, und schließlich der
älteste, größte und berühmteste von allen, der Circus Maximus.
3.2. Das Theaterspiel
Die Römer übernahmen erst im letzten
vorchristlichen Jahrhundert den griechischen Theaterbau. Vorher wurden für
Komödien und Tragödien nur provisorische Bühnengerüste und Zuschauerbänke aus
Holz errichtet. Mit dem Bau des ersten steinernen Theaters in Rom durch
Pompeius im Jahre 55 v. Chr. findet Rom zu einer vom griechischen Theaterbau
abweichenden Konzeption, die sich in der Folgezeit im gesamten Mittelmeergebiet
einschließlich des griechischen Sprachbereiches durchsetzt. Das römische
Theater ist ein monumentaler Bau, dessen nach allen Seiten hin gleich hohe
Außenfront eine Einheit bildet. Diese Einheit zeigt sich auch im Innern durch
den architektonischen Zusammenschluss des Bühnengebäudes mit dem Zuschauerraum.
Neben den großen Theaterbauten gab es noch den kleineren, überdachten
Theatertypus. Dieser Theatertyp hieß Odeum und war als Saalbau für musikalische
Aufführungen und Rezitationen gedacht. Am bekanntesten ist das Odeum von
Pompeji, das 80 - 75 v. Chr. entstand und neben dem großen Theater liegt.
3.3.
Verschiedene
Theaterinszenierungen:
3.3.1.
Die
Fabula Atellana
Hierbei handelte es sich um eine
knappe, drastische Volksposse, in der es um Essen und Trinken, um derbe Lebensart
aus dem Landleben ging. Die leicht hingeworfene Handlung wurde „trica"
genannt - was wohl soviel wie unsere Intrige bedeutet. Prügeleien,
Trunkenheitsszenen und schaurig-komische Gespensterbegebnisse waren die häufigsten
Bestandteile der Handlung. Ein weiteres typisches Merkmal der fabula Atellana
war die kräftig-holzschnittartige Sprache voll der volkstümlichen und dialektnahen
Kraftausdrücke, in der sich die Darsteller unter lebhaften Gestikulationen bewegten.
3.3.2.
Der
Mimus
 Der Mimus wurde ursprünglich von
Gaukler, Clowns und Artisten, die durch die Länder zogen, auf dem Markt oder
bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Bald entwickelten sie sich zu einem
festen Bestandteil der offiziellen Staatsfestlichkeiten, die zu Ehren der Götter
abgehalten wurden. In den großen Pausen der Tragödien und Komödien spannte man
vor die Hinterbühne ein breites Segeltuch (siparium), so dass während der
Umbauten diverser Requisiten im Vordergrund ein Mimus-Spiel, meist mit Tanzeinlagen
und Flötenbegleitung aufgeführt werden konnte. Das siparium als neutraler
Hintergrund des Geschehens aber wurde fester Bestandteil des Mimus, da es die
Aufmerksamkeit allein auf den agierenden Schauspieler lenkt. Im Mimus ging es
um die Kunstfertigkeit der Lebensnachahmung. Tierstimmen, Meeresrauschen, vor
allem aber die Eigenart der menschlichen Ausdrucksweise wurden nachgeahmt. Die
Hauptthemen des Mimus-Spiels waren nicht selten Ehebruch und Diebstahl, in deren
Handlung immer das Unerwartete geschehen musste (Arme werden reich, Millionäre
zu Bettlern,...).
Der Mimus wurde ursprünglich von
Gaukler, Clowns und Artisten, die durch die Länder zogen, auf dem Markt oder
bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Bald entwickelten sie sich zu einem
festen Bestandteil der offiziellen Staatsfestlichkeiten, die zu Ehren der Götter
abgehalten wurden. In den großen Pausen der Tragödien und Komödien spannte man
vor die Hinterbühne ein breites Segeltuch (siparium), so dass während der
Umbauten diverser Requisiten im Vordergrund ein Mimus-Spiel, meist mit Tanzeinlagen
und Flötenbegleitung aufgeführt werden konnte. Das siparium als neutraler
Hintergrund des Geschehens aber wurde fester Bestandteil des Mimus, da es die
Aufmerksamkeit allein auf den agierenden Schauspieler lenkt. Im Mimus ging es
um die Kunstfertigkeit der Lebensnachahmung. Tierstimmen, Meeresrauschen, vor
allem aber die Eigenart der menschlichen Ausdrucksweise wurden nachgeahmt. Die
Hauptthemen des Mimus-Spiels waren nicht selten Ehebruch und Diebstahl, in deren
Handlung immer das Unerwartete geschehen musste (Arme werden reich, Millionäre
zu Bettlern,...).
3.3.3.
Der
Pantomimus
Im Gegensatz zum Mimus, in dem die Sprache dem
Gebärdenspiel beigefügt war, wird im Pantomimus ausschließlich das
Gebärdenspiel verwendet in Verbindung mit symbolischem Tanz. Die ganze Kunst
des Pantomimus liegt vor allem beim ausdrucksstarken Spiel der Arme und Hände,
besonders aber der Finger. Von ballett-ähnlichen Gattungen unterscheidet sich
der Pantomimus dadurch, daß in ihm ein einziger Darsteller alle Rollen des
Stückes spielt, wozu er entsprechend Kostüm und Maske wechselte.
3.3.4. Die römische
Tragödie
Die Entwicklung der römischen Tragödie ist
untrennbar mit den beiden Namen Livius Andronicus und Gnaeus Naevius verbunden.
Andronicus war griechischer Sklave, dessen große Sprachbegabung man schnell
erkannte. Er übertrug als erster Homers Odyssee ins Lateinische und als erster
wagte er es auch, bei den ludi Romani 240 v. Chr. griechische Dramen in
lateinischer Sprache auf die Bühne zu bringen. Da Rom erst 55 v. Chr. ein
großes steinernes Theater erhielt, musste sich Andronicus mit einem Brettergerüst
behelfen. Der andere römische Dramatiker, Gnaeus Naevius, versuchte, Drama und
Theater in den Dienst der Kritik des Volkes an der römischen Staatslenkung zu
stellen. Der Versuch scheiterte. Das Theater war zu sehr in der Hand der
Machthaber, diese bestimmten, was aufgeführt werden durfte und was nicht. Wenige
Jahre später wurde Naevius zum Begründer der „fabula praetexta" oder „praetextae".
Die Praetextae waren Römer- und Königsdramen, in denen oft die Typen der römischen
Würdenträger vorkamen und wichtige Rollen spielten.
3.3.5.
Die
römische Komödie
 Die römische Komödie entwickelte
sich in einigen, strukturell verschieden gearteten Sonderausprägungen. Die früheste
unter ihnen ist die „Palliata", d. h. eine nach griechischen Vorbildern
entstandene und in Griechenland spielende Komödie. Ihr Entfaltungsraum
erstreckt sich über die zweite Hälfte des dritten und die erste Hälfte des
zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. An ihrer Ausgestaltung ist neben
Andronicus und Naevius eine große Zahl anderer römischer Dramatiker beteiligt.
Die Palliata hält sich eng an das Vorbild der neueren griechischen Komödie.
Von ihr hat sie die Art des Handlungsaufbaues und der Charaktergestaltung.
Prolog und Epilog werden ebenfalls übernommen. Und wie in der neueren Komödie
finden sich in der Palliata neben gesprochenen Vers-Partien auch gesungene oder
musikalisch begleitete. Wie in der neueren griechischen Komödie, ging es auch
in der Palliata vorerst um die Liebe eines Jünglings zu einer Hetäre, um die Mittel,
derer er sich bedient, sie für sich zu gewinnen, um das Wiederfinden ihrer
verloren geglaubten Eltern und um ihre Rückgliederung ins bürgerliche Leben.
Die Sklavenrolle kommt auch in der römischen Palliata zentrale Bedeutung zu.
Ansonsten findet man als Hauptgestalten besorgte Väter, leichtsinnige Söhne,
brutale Kuppler und geld- und liebeshungrige Hetären. Meist handelte es sich um
Charakterkomödien oder um Intrigenkomödien.
Die römische Komödie entwickelte
sich in einigen, strukturell verschieden gearteten Sonderausprägungen. Die früheste
unter ihnen ist die „Palliata", d. h. eine nach griechischen Vorbildern
entstandene und in Griechenland spielende Komödie. Ihr Entfaltungsraum
erstreckt sich über die zweite Hälfte des dritten und die erste Hälfte des
zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. An ihrer Ausgestaltung ist neben
Andronicus und Naevius eine große Zahl anderer römischer Dramatiker beteiligt.
Die Palliata hält sich eng an das Vorbild der neueren griechischen Komödie.
Von ihr hat sie die Art des Handlungsaufbaues und der Charaktergestaltung.
Prolog und Epilog werden ebenfalls übernommen. Und wie in der neueren Komödie
finden sich in der Palliata neben gesprochenen Vers-Partien auch gesungene oder
musikalisch begleitete. Wie in der neueren griechischen Komödie, ging es auch
in der Palliata vorerst um die Liebe eines Jünglings zu einer Hetäre, um die Mittel,
derer er sich bedient, sie für sich zu gewinnen, um das Wiederfinden ihrer
verloren geglaubten Eltern und um ihre Rückgliederung ins bürgerliche Leben.
Die Sklavenrolle kommt auch in der römischen Palliata zentrale Bedeutung zu.
Ansonsten findet man als Hauptgestalten besorgte Väter, leichtsinnige Söhne,
brutale Kuppler und geld- und liebeshungrige Hetären. Meist handelte es sich um
Charakterkomödien oder um Intrigenkomödien.
4. Quellenverzeichnis:
-
Internet:
§
http://depthome.brooklyn.cuny.edu/classics/gladiatr
§
www.lateinforum.de
-
Sonstiges:
§
Encarta Professional 2002
-
Literatur :
§
Robert Etienne – “Pompeji” Das Leben in einer antiken Stadt (Reclam
Verlag) S.350 – 410